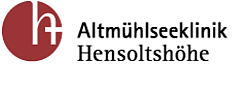Zu Beginn des Rehabilitationsverfahrens sollten die Ergebnisse aus Diagnostik und Vorbehandlungen ausführlich dokumentiert vorliegen. Sie sollten Angaben über den Primärsitz des Tumors, das Datum der Erstdiagnose, Befunde der histologischen Untersuchung und den Grad der anatomischen Tumorausbreitung (TNM-System) umfassen. Angaben sollten vorhanden sein zu Operationsverfahren und Operationsausmaß. Form und Ergebnis der zytostatischen Therapie, Form und Ergebnis der Strahlentherapie sowie Angaben über zusätzliche therapeutische Maßnahmen. Wichtig sind Informationen über postoperative Komplikationen wie Wundheilungsstörungen, Abszessbildungen und komplizierende Begleiterkrankungen wie z. B. Diabetes mellitus, Leberzirrhose, Herzinsuffizienz und andere, die Wundheilung und körperliche Belastbarkeit betreffende Grunderkrankungen. Insbesondere Erkrankungen, die einen relevanten Einfluss auf den Rehaverlauf und die zu verwendenden physikalischen Anwendungen haben, sollten bekannt sein.
Umfang und Schweregrad der funktionellen Einschränkungen sowie der sozialen Beeinträchtigungen sollten bereits im Vorfeld der Rehabilitationsmaßnahme geklärt sein. Aus diesem Bereich definieren sich die Rehabilitationsbedürftigkeit und auch die Rehabilitationsfähigkeit. Hilfreich sind Angaben über soziale Belastungsfaktoren, häusliche Versorgung, berufliche Situation und über den bisherigen Grad der psychischen Krankheitsverarbeitung.